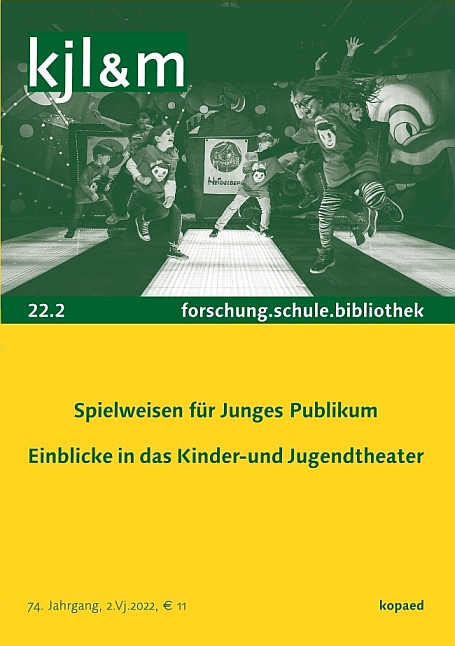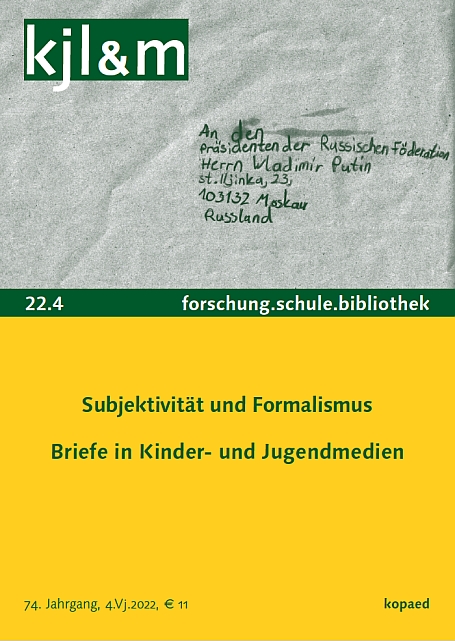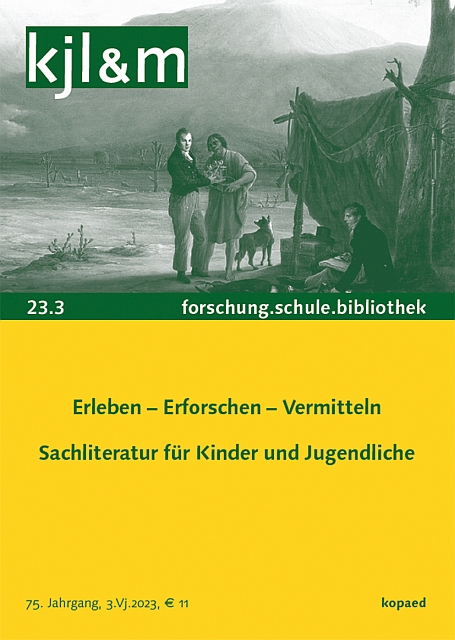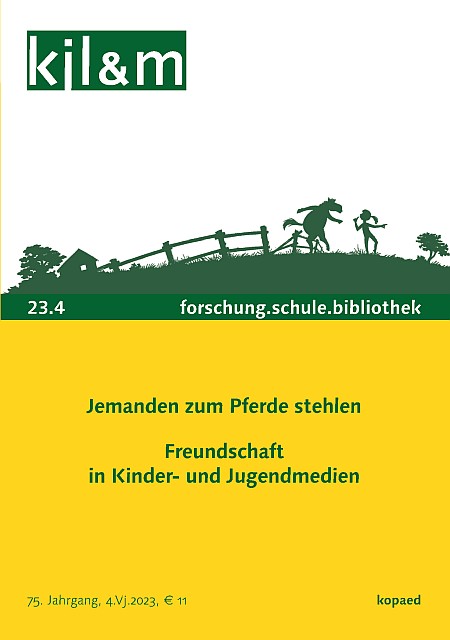von Bianca Hillebrandt
Wer erinnert sich nicht an die traditionell vorgelesene Gutenachtgeschichte vor dem Schlafengehen? An die Lieblingsbücher der Kindheit, in denen der Held gegen einen Bösewicht kämpfen musste und man allabendlich eifrig mitfieberte, ob das Abenteuer wohl gut ausgehen würde oder am Ende doch das Böse siegt.
Bücher sind ein wichtiger Bestandteil jeder Kindheit. Das Vorlesen von Geschichten regt die kindliche Fantasie an und im besten Fall wachsen begeisterte, neugierige und wissenshungrige kleine Leser heran, die ganz erpicht darauf sind, endlich selbst all ihre Kinderbücher bis zur letzten Seite verschlingen zu können. Doch in unserer heutigen Zeit, in der bereits im Kindergartenalter in vielen Kinderzimmern Playstation, Fernseher & Co die gefüllten Wandregale ablösen, haben es Bücher mitunter schwer. Hinzu kommt, dass in vielen Familien das abendliche Ritual des Vorlesens oft aus Zeitmangel gänzlich in den Hintergrund rückt. Doch gerade durch regelmäßiges Vorlesen werden Kinder dazu ermutig, später selbst zu einem Buch zu greifen.
Um Kinder an eine eigenständige Lektüre heranzuführen, muss die Lesemotivation sowohl zu Hause als auch in Schulen und anderen Institutionen, wie z. B. Bibliotheken, rechtzeitig gezielt gefördert werden.
Aktuell hat sich die studentische Projektgruppe um Prof. Susanne Krüger und Katharina Schaal (MA) mit dem Thema auseinandergesetzt. Dabei beschäftigten sie sich damit, inwieweit speziell Bibliotheken zur Förderung der Lesemotivation beitragen können. Ihre Ergebnisse haben sie nun in ihrer kostenlosen Broschüre „Tatort Bibliothek: Wir kriegen sie alle! – Ideen zu Förderung der Lesemotivation“ veröffentlicht. Darin stellen sie unterschiedliche, leicht umsetzbare Methoden dar, mit denen Bibliotheken sich die Konzentration der Kinder beim Vorlesen sichern können und auf diese Weise einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Lesemotivation leisten. Darüber hinaus können der Broschüre weiterführende Informationen zum Angebot des IfaKs entnommen werden („Institut für angewandte Kindermedienforschung“ http://www.ifak-kindermedien.de/).
Wenn Sie sich für die Broschüre interessieren, besuchen Sie einfach die folgende Adresse: http://www.hdm-stuttgart.de/ifak/startseite/Tatort_Bibliothek.pdf .