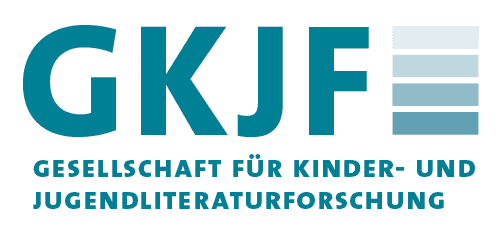[14.07.2020]
Das Jahrbuch der Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung des Jahres 2021 fidmet sich dem Thema "Klänge". Abstracts können bis zum 15. September 2020 eingereicht werden.
Kinder- und Jugendliteratur und ihre Medien sind stets auch eine Symphonie bzw. Polyphonie von Klängen. Bereits das Wort "Klänge" stimmt in diesem Zusammenhang ein ganzes Konzert von Assoziationen an. Der Begriff führt zu einem Spektrum an Hörphänomenen, die die komplexen Bereiche Laut/Ton, Wort/Sprache und Musik sowie Geräusche jedweder Couleur umfassen. Eine Beschäftigung mit "Klänge" impliziert zugleich die Auseinandersetzung mit Fragen der Sinneswahrnehmung(en) ebenso wie zur Klangkunst, sei es in klassischer, in experimenteller oder populärkultureller Ausprägung. Die Bandbreite literarischer Klänge erstreckt sich von den vielgestaltigen Aspekten des Lyrischen (des Liedes, der lyrics etc.) zu Fragen intermedialer Referenzen, die sich an Texten ablesen lassen, bis hin zum spezifischen Sound und Soundtrack in Kinder- und Jugendmedien. Dabei tönt und dröhnt es nicht allein aus jugendliterarischen Texten, Klänge werden beispielsweise auch in Bilderbüchern hörbar. Politische wie ideologische Botschaften klingen an; narratologische Fragen kommen ins Spiel, wenn zum Beispiel von der Stimme des Erzählers oder dem kindgemäßen Ton die Rede ist oder vom schnellen Beat eines Romans. Klänge werden durch Sprachmelodien eingewoben, durch fremdsprachliche Zitate eingespielt, durch montierte und collagierte Geräusche dem Text unterlegt. In Klängen bildet sich zwitschernd und rauschend Natur ab, die (literarische, komponierte) Symphonie der Großstadt setzt Metropolen ein Sound-Denkmal.
Auch in medialen Kontexten – im Bereich der Hörmedien ebenso wie in Bild-Medien – spielen Klänge eine ganz zentrale Rolle. Zu fragen ist deshalb nach den Zusammenhängen von Klang und Medien bzw. Medienentwicklung im Spiegel aller kinder- und jugendmedialen Produkte und Praxen.
Das open access, peer-reviewed Jahrbuch der Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung stellt 2021 das Thema "Klänge" in den Mittelpunkt, um historische wie gegenwärtige Dimensionen dieses komplexen Gegenstands in den Blick zu nehmen. Die Beiträge sollten die vielfältigen Implikationen dieses Themenkomplexes sowohl aus theoretischer wie gegenstandsorientierter Perspektive in seinen unterschiedlichen Gattungsschwerpunkten wie medialen Gestaltungsformen (Bilderbücher, Comics, Graphic Novels, Filme, Fernsehen, Computeranwendungen) aufgreifen und zugleich vor dem Hintergrund ihrer Bedeutung für die heutige Kinder- und Jugendmedienforschung diskutieren.
Mögliche Themen, Aspekte, Zugänge und Schwerpunkte, jeweils mit Bezug auf Kinder- und Jugendliteratur bzw. -medien, wären:
- Sprachformen | Erzählformen | Narrative
- Intermedialität und Materialität
- Bild-Medien (insbesondere Bilderbuch, Graphic Novels)
- Interdisziplinäre Aspekte der Klang-Künste
- Hörmedien
- Audiovisuelle Medien: Filme, Serien, ...
- Sinneswahrnehmungen | Gefühlsforschung
- Musik und Gesang
- Politische Aspekte, ideologische Implikationen (Stichwort RechtsRock)
- Anthropologische Fragestellungen
- …
Über das Schwerpunktthema hinaus sind zudem bis zu drei offene Beiträge zu kinder- und jugendmedialen Fragestellungen aus historischer wie theoretischer Perspektive erwünscht; auch hier bitten wir um entsprechende Vorschläge.
Formalia
Wir hoffen auf große Resonanz und bitten bei Interesse um die Zusendung von entsprechenden Angeboten für themenbezogene bzw. offene Beiträge – zunächst (d.h. bis zum 15.09.2020) in Form eines Abstracts von nicht mehr als 300 Wörtern. Die Abstracts sollten außer einer kurzen inhaltlichen Zusammenfassung Angaben über die Fragestellung machen, den Bezug zu theoretischen Positionen herstellen sowie die Literatur nennen, auf die sich der Beitrag stützt.
Die Beiträge selbst sollten einen Umfang von 40.000 Zeichen (inkl. Fußnoten und Literaturverzeichnis) nicht überschreiten und den Herausgeberinnen spätestens bis zum 01.03.2021 als Word-Dokument vorliegen.
Bitte senden Sie Ihre Abstracts an:
Ein Style Sheet wird nach Annahme der Abstracts verschickt.
Das Jahrbuch der Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung | GKJF 2021 wird im Dezember 2021 online veröffentlicht.
[Quelle: Call for Papers]