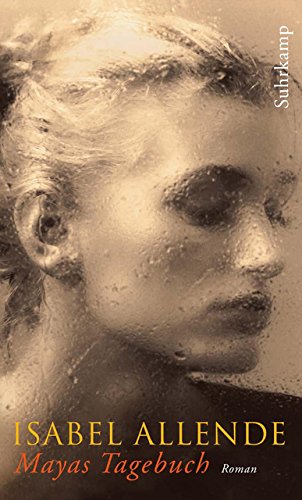Inhalt
Mayas Geschichte beginnt mit ihrer Reise zu einer kleinen Insel, die zum Chiloé-Archipel gehört. Dort soll sie leben, bis eine Rückkehr in die USA wieder sicher für sie ist. Denn Maya wird von der Polizei und einer gefährlichen Verbrecherbande gesucht – beide bedeuten großen Ärger für sie.
Mayas Vergangenheit, genauso wie ihr neues Leben in Chiloé wird stückchenweise durch ihre niedergeschriebenen Erinnerungen freigelegt. Die behütete Kindheit nahm mit 16 Jahren ein rasches Ende, als ihr geliebter Großvater "Pop" starb, es folgten Drogen und Kleinverbrechen. Sie landete auf Anweisung ihres eher durch Abwesenheit glänzenden Vaters in einem Internat für schwererziehbare Jugendliche, entkam und reiste per Anhalter nach Las Vegas. Schon die Fahrt zur "Stadt der Sünde" stellte sich als traumatisches Erlebnis heraus, und einmal dort angekommen, schien es unmöglich, kriminellen Machenschaften zu entkommen. Mayas Verhalten und die Gefährlichkeit der Menschen in ihrem Umfeld wurden schließlich auf die Spitze getrieben; nur im letzten Moment gelang es ihr sich zu retten und zu ihrer Großmutter zurückzukehren, die sie sogleich nach Chile schickte.
Dort lebt sie bei dem Anthropologen Manuel und hat trotz der Arbeit für ihn und die Dorfschule viel Zeit, um über ihr bisheriges Leben nachzudenken. Zwischen starken Frauen, ungebrochenen Traditionen und der rauen See soll sie ausnüchtern, sich selbst finden und vor allem nicht gefunden werden.
Kritik
Maya ist eine Antiheldin wie sie im Buche steht, hat alles falsch gemacht und ist trotzdem liebenswert. Das liegt vor allem an der Ehrlichkeit, mit der sie auf ihr bisheriges Leben zurückschaut und sich selbst wüst beschimpft.
Poetische Beschreibungen von Land, Leute und Geistern – denn wie jedes von Allendes Büchern ist auch dieses beeinflusst von ihrer Liebe zum Übernatürlichen und dem für sie typischen südamerikanischen "Magischen Realismus" – wechseln sich mit Mayas Erinnerungen an ihre Vergangenheit ab. Die behütete Kindheit in einem bunten Haus, geprägt durch ihren geliebten Großvater "Pop", der sie zum Sternengucken und Träumen erzieht, steht im Kontrast zu ihrer harten Jugend. Alltäglicher Drogenrausch und pädophile Männer, die Maya und ihre Gefährtinnen hinters Licht führen, werden genauso schonungslos beschrieben wie Vergewaltigungen und Prostitution. Das lässt erschrecken, innehalten, überlegen. Was weiß ich von dieser Welt? Würde ich jemandem wie Maya helfen?
Maya hat diese Zeit überlebt, nur knapp, und nun steht ihr Leben auf Pause. Zukunft? Ungewiss. Trotzdem kommen Erzählungen aus Chile nicht zu kurz. Ist sie anfangs noch die beobachtende gringuita und erinnern ihre Beschreibungen an die eines Anthropologen, wie Manuel, bei dem sie lebt und für den sie arbeitet, wird sie im Laufe des Buches immer mehr Teil der Gemeinschaft. Gemeinsam mit dem Straßenhund Fákin, "Fucking dog auf Chilenisch" (S.29), wie sie Manuel erklärt, der diese Art von Humor nicht teilt, erkundet sie die Insel. Sie lernt die eigentümlichen Dorfbewohner zu verstehen und erweckt damit Fernweh nach einem Ort über den Manuel weiß: "Von auswärts kommt nur, wer genug hat von der Welt. Niemand zieht sich hierher zurück, bevor er überhaupt angefangen hat zu leben." (S.380)
Mit den Kindern des Dorfes Fußball zu spielen, am Hexensabbat teilzunehmen und sich zu verlieben, all das hilft Maya wieder zu sich selbst zu finden, genauso wie der Geist ihres Pops, der ihr in diesem magischen Land häufiger begegnet als im vernebelten Drogenrausch Las Vegas' und wortlos zur Seite steht. Maya beschreibt ihren Neuanfang in Chile so:
Mir ist, als wäre ich im letzten Jahr kopfvor hinab ins Dunkel gestürzt. Wie ein Samenkorn oder eine Wurzelknolle war ich unter der Erde, und eine neue Maya Vidal drängte ins Freie; mir sind Wurzelfädchen gesprossen auf der Suche nach Feuchtigkeit, dann Wurzeln wie Finger auf der Suche nach Nahrung und schließlich Stiel und Blätter, die entschlossen ans Licht wollen. Jetzt treibe ich offenbar Blüten, deshalb kann ich die Liebe erkennen. Hier im Süden der Welt macht der Regen alles fruchtbar. (S. 244-245)
Allendes bildhafte Sprache, bei der Tiere und Pflanzen häufig als Metaphern dienen, wirkt in diesem Roman nicht verkitscht, setzt sie doch einen schönen Kontrast zu den Grausamkeiten Las Vegas' und dem von Einfachheit geprägten, aber nicht gerade einfachem Leben in Chile.
Ein ganzes Jahr, das nur grob in Jahreszeiten aufgeteilt wird, verbringt Maya dort und hilft damit nicht nur sich selbst, sondern auch anderen. Dass Pop nicht ihr leiblicher Großvater ist, wusste sie schon immer, wessen Blut stattdessen durch ihre Adern fließt, erfährt sie auf der kleinen Insel. Damit einher geht auch eine Beschäftigung mit dem dunkelsten Kapitel der chilenischen Geschichte, der Militärdiktatur, das Maya unerschrocken aufschlägt. Wer einmal angefangen hat sich den schrecklichen Seiten des Lebens zu stellen, hört nicht mehr damit auf und konfrontiert auch die Menschen in seiner Umgebung mit ihren eigenen Traumata. Das Unglück macht vor keinem Ort der Welt Halt und sei er noch so abgeschieden, lernen die Leserinnen und Leser. Misshandelte Kinder und Erwachsene, Krankheiten und Tod gibt es überall. Allende selbst sagt: "Ich habe diese Maya Vidal sehr gern, nicht zuletzt weil sie viele Züge der sechs Halbwüchsigen aus meiner eigenen Familie trägt, die ständig ungezählten Gefahren ausgesetzt sind. Genau wie Mayas Großmutter versuche auch ich, die Kinder zu beschützen, weiß aber doch, dass am Ende alles eine Frage von Glück ist." (http://www.suhrkamp.de/isabel-allende/mayas-tagebuch_941.html)
Der Roman weist auch einige Schwächen auf. Die Geschichte ist nicht so langatmig, wie es Allendes Romane für Erwachsene sein können; dafür passiert zu viel und die Spannung hält bis zum Ende an. Aber es tauchen Wiederholungen auf. So haben die Leserinnen und Leser längst begriffen, dass auf der Insel ein komplizierter Tauschhandel den Supermarkt ersetzt, während Maya immer noch davon berichtet. Liegt es daran, dass Mayas Kopf immer noch von Drogen vernebelt ist oder hat die Autorin den Überblick verloren?
Die Guten sind nicht unbedingt gut, haben an ihrer Last zu tragen, sind häufig unfreundlich und lassen niemanden an sich heran. Aber die Bösen sind böse, ohne großes Wenn und Aber und schon gar nicht Warum. Das Bild, das Allende damit von der Welt zeichnet, ist schwarz-grau mit einigen weißen Tupfern. Das ist sicherlich besser als ein mit erhobenem Zeigefinger drohender Roman in Schwarz-weiß, der Jugendlichen vermitteln will, wie gefährlich Drogen sind. Aber es geht noch besser, noch tiefgehender – nur müsste man dafür vermutlich die Geschichte aus mehreren Perspektiven erlebt haben und zudem Allendes Talent für Worte besitzen.
Fazit
Allende behandelt in diesem 445-seitigen Roman viele Themen: Familie, Heranwachsen, Herkunft, Drogen, Liebe, Spirituelles, Trauma, Diktatur, Verbrechen. Dabei bleibt keines zu kurz, ganz im Gegenteil, die Fülle an Geschichten und Figuren führt dazu, dass man am Ende das Gefühl hat, Maya ganz genau zu kennen. Allende ist etwas viel besseres als ein Tagebuch gelungen, sie offenbart Mayas Seele.
Das lässt zutiefst erschrecken, weil es eine Welt zeigt, die den meisten Jugendlichen hoffentlich erspart bleibt. Angst und Misstrauen werden gesät, aber auch Hoffnung: Wenn Maya ihre Geschichte durchgestanden hat, dann ist alles möglich, dann kann ich alles schaffen.
Die Protagonistin ist 19 Jahre alt, als sie in Chile ankommt; Leserinnen und Leser ihres Tagebuchs sollten nicht allzu viel jünger sein. Auch für Ängstliche ist dieses Buch nichts oder vielleicht gerade doch, denn auch Maya wird stets von Angst und Schlaflosigkeit begleitet und schafft es trotzdem durchs Leben zu kommen.
- Name: Allende, Isabel
- Name: Svenja Becker